 Alter Wein in alten Schläuchen
Alter Wein in alten Schläuchen
„Wir leben nicht in einer Ära des Wandels, sondern erleben den Wandel einer Ära.“ Das sagte Papst Franziskus den italienischen Bischöfen. Ein tiefgreifender Wandel finde statt. Diesen gelte es zu meistern.
Und dazu genügen nicht kleine Reformen. Mut ist dazu erforderlich. Er, der Papst, besitzt diesen. In fünf Jahren hat er die katholische Kirche verändert: Neu sind Strukturen. Eine Dezentralisierung ist im Gang. Der Papst ist überzeugt, dass der Heilige Geist nicht nur in Rom wirkt. In seiner Regierungserklärung „Evangelii gaudium“ zitiert er 40mal regionale Bischofskonferenzen. Als die vier „dubia-Kardinäle“ eine Antwort auf ihren Brief zu Amoris laetitia warten, übernimmt er ein Hirtenwort der argentinischen Bischöfe und erhebt sie in den Rang einer authentischen Lehre. 2019 wird voraussichtlich die Amazonassynode die Ordination verheirateter Katechisten beschließen. Der Papst wird anwesend sein. Viel vermuten, dass er den Bischöfen Amazoniens sagt: Wenn ihr genug gebetet und gefastet hat und ihr diese Entscheidung für richtig und notwendig erachtet, dann macht es. Das wird dann auch andere Bischofskonferenzen ermutigen. Der alte Satz „Roma locuta, causa finita“ zählt nicht mehr. Jetzt wird nicht mehr alles von der Zentrale in Rom ausgehen. Vielmehr wird Rom von regionalen Kirchen lernen. Die katholische Weltkirche lernt also Synodalität und Subsidiarität. Dabei wird die Verantwortung des Papstes nicht aufgegeben. Aber sie wird anders kultiviert. So entwickeln sich in epochaler Weise kirchliche Strukturen. Das ist eine Dimension der neuen Ära.
Aber nicht nur die Strukturen werden entwickelt. Es werden auch die Akzente in der Pastoralkultur verschoben. Der Akzent wandert von der Sünde zur Wunde, vom Moralisieren zum Heilen. Die Kirche führt die Menschen nicht mehr in den Gerichtssaal, sondern in ein Feldlazarett. Der Akzent wandert vom Gesetz zum Gesicht. Es wird nicht mehr das allgemeine Gesetz auf alle unterschiedslos angewendet.
Vielmehr zählt der Einzelfall, dem das Gesetz dient. Und wenn das Gesetz im Einzelfall schadet, kommt das Erbarmen als Vollendung des Gesetzes und der Gerechtigkeit Gottes zum Tragen. Wer das Gesetz ohne Erbarmen anwendet, wird leicht zum Ideologen. Der Papst, so Antonio Spadaro in einem Interview mit Andreas Batlogg über den Papst, ist kein Ideologe, sondern ein Hirte.
Dieser Papst redet daher nicht nur theoretisch über einen Wandel der Ära. Er treibt diesen auch voran. Auf diese Weise führt er auch die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils fort. Von hier aus wird auch der wachsende Widerstand gegen den Papst verständlich. Dieser richtet sich nicht so sehr gegen die Person des liebenswürdigen Papstes, sondern gegen den Weg, auf den er die Kirche entschlossen führt.
Wir blicken kurz in die vergangene Ära zurück. Wir nennen sie die Konstantinische Ära. IN ihr war Europa „durchmissioniert“, dank der engen Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat. In der nachreformatorischen Zeit wurde diese Verbindung aus politischen Gründen von verstärkt. Christsein war für die Menschen in dieser Zeit ein unentrinnbares Schicksal. Wer zum Beispiel in Österreich nicht römisch-katholisch sein wollte, wurde ins Jenseits oder später ins Ausland ausgewiesen.
Diese Ära war aber nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Es ist auch eine Geschichte von Blut und Tränen, die tiefe Spuren in der Europäischen Kultur hinterlassen hat. Der blutige Religionskrieg, der dreißig Jahre währte (1618-1648), hat die Reputation der christlichen Konfessionen in Europa schwer beschädigt. „Das Christentum führte Krieg gegen das Christentum“ – so wie heute der „Islam Krieg gegen den Islam führt“, wie der deutsche islamische Schriftsteller Navid Kermani formuliert hat. Gott und Gewalt waren eng verbunden. Das brachte Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit. Die Folge war zunächst eine Entkirchlichung breiter Bevölkerungskreise. Voltaire wollte eine Weltreligion ohne Konfessionen, ohne Kirchen. Friede sei nur möglich, wenn man der Religion die Waffen und den Mächtigen die Religion nimmt. Die Entwicklung setzte sich aber fort. Es kam in Frankreich der Europäische Atheismus auf. Er wollte die Menschen nicht nur vor den Kirchen, sondern vor jenem Gott schützen, dessen Namen die Mächtigen missbrauchten, um Kriege zu rechtfertigen.
Diese Konstantinische Ära in ihrer reformatorischen Gestalt ist nun definitiv zu Ende. Das Christentum ist für die Menschen in Europa heute „nicht mehr Schicksal, sondern Wahl“, so der große Religionssoziologe Peter L. Berger. Für diese Wahl genügen nicht kulturelle Traditionen, sondern es braucht attraktive Gratifikationen: „Warum ist das Evangelium für unser Leben und Zusammenleben ein Segen?“ Warum tut es den Einzelnen, aber auch der Gesellschaft gut? Und das im Europa von heute! Die Kirchen haben sich zu lange auf die Tradition verlassen und das aggiornamento vergessen. Kardinal Carlo M. Martini sagte kurz vor seinem Tod: „Die katholische Kirche ist 300 Jahre hinter der Zeit zurück.“ Um es mit dem Bild aus einer Rede von Jesus zu sagen: „Der Wein ist alt geworden.“ Alt und brüchig sind auch die Schläuche: also die vormodernen, hierarchischen Strukturen, der Klerikalismus, die antiquierten Rollenbilder von Mann und Frau, die Angst vor den Menschenrechten, vor dem Kampf der Frauen für Gerechtigkeit, der in der Kirche kurzsichtig als Genderideologie bekämpft wird. Vormodern ist nicht zuletzt das Verhältnis zu den vielfältigen Gestalten von Sexualität und der Liebe zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern.
Die katholische Kirche ist also in Europa heute in einer dramatischen Übergangszeit. In solchen Zeiten ist die Versuchung groß, lediglich den überkommenen Kirchenbetrieb den sinkenden Zahlen an Kirchenmitgliedern, Priestern, Ordensleuten und Finanzen anzupassen. „Downsizing“, das Verkleinern des traditionellen Kirchenbetriebs steht auf dem Programm. Dabei werden paradoxer Weise die pastoralen Räume immer größer. Der Altbischof Reinhold Stecher sagte einmal: Die Kirche klagt, dass sich die Menschen von der Kirche entfernen. Wahr ist aber, dass sich die von den Menschen entfernt.
Die Reformen, die heute stattfinden, gehen nicht weit genug. Sie bleiben der alten Ära verbunden. Denn viele Diözesen reformieren ihre Strukturen im bestehenden Rahmen, aber sie reformieren nicht den Rahmen selbst. Das hat fatale Auswirkungen auf das Wirken der Kirche in Europa. Denn durch die Strukturreformen werden die Kräfte innerkirchlich gebunden. Eine Art Kirchenimplosion findet statt. Das Schicksal der Welt und der Menschen gerät aus dem Blick. „Eine Kirche, die sich mit sich selbst beschäftigt, wird krank“, diagnostiziert Papst Franziskus.
Junger Wein in neuen Schläuchen
Haben wir also in Europas Kirchen alten Wein in alten Schläuchen? Manche Verantwortliche werden entgegnen: Wir beschwören doch seit Jahren eine Neuevangelisierung Europas. Wir rufen zur Mission auf. Wir schaffen doch mit enormer Anstrengung neue Schläuche, errichten neue pastorale Strukturen.
Dennoch halten alle diese strukturellen Maßnahmen den Niedergang der alten Ära nicht auf. Noch weniger führen sie uns mutig in die neue Ära. Wir flicken die alten Schläuche. Aber es fehlt uns der junge Wein. Lassen sie mich daher ein wenig über den jungen Wein meditieren.
Papst Franziskus mahnt uns unentwegt, die Bibel in die Hand zu nehmen. Diese lehrt uns, dass alles seinen Anfang bei Gott hat. Dieser hat in seiner Menschwerdung demonstriert, dass ihm der Mensch und die Welt am Herzen liegen. Durch den Tod am Kreuz hindurch ist er in der Auferstehung ins Herz der Welt eingegangen. Dort finden wir jetzt nicht mehr Tod und Vergeblichkeit, sondern Gott und das Leben. So Papst Franziskus in Anlehnung an einer Osterpredigt von Karl Rahner. Gott wurde Mensch, damit die Welt – geeint mit Gott – menschlicher werde
In der Menschwerdung praktizierte Gott aber „Kenosis“ (Selbstentäußerung). Gott verließ sich selbst und wurde einer von uns. Dasselbe mutet er uns, seinem Volk zu: Dass wir von uns absehen, aus uns herausgehen, und in die Welt von heute eintauchen, in die Freuden und Leiden der Menschen. Daher lautet die erste Frage für eine Kirche auf dem Weg in eine neue Zukunft: Wie steht es um die Welt, um die Menschen? Was ist ihre Hoffnung und Freude, ihre Trauer und Angst – so die Grundverfassung, die Pastoralkonstitution, der Konzils.
Mit den Päpsten Johannes XXIII. und Franziskus zähle ich mich nicht zu den „Unglückspropheten“, die nur das Dunkle sehen; die Säkularisierung, die Entkirchlichung, den Relativismus. Vielmehr kennt diese Welt große Errungenschaften. Die Leistungen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Medizin sind enorm. Heute verhungern weniger Kinder, die Zahl der Analphabeten sinkt, die Achtung der Menschenrechte weitet sich aus, immer mehr Völker rufen nach Freiheit, die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern wächst. Die Kraft der Zivilgesellschaften nimmt zu. Viele engagieren sich für jene, die in Not sind. Selbstlose Solidarität findet sich nicht nur bei Christen, sondern bei vielen Menschen guten Willens.
Es gibt allerdings auch die dunkle Seite. Das Ökosystem droht zu kollabieren. Das derzeitige Finanzund Wirtschaftssystem ist höchst labil. Die Güter der Welt sind in wachsender Weise ungerecht verteilt. Die Folge sind soziale Unruhen und lokale Kriege. „Diese Wirtschaft tötet“, so Papst Franziskus. Der „Schrei der Armen“ in der Einen Welt ist immer lauter. Korruption verschärft die Lage in vielen armen Regionen der Erde. Dazu kommt die kulturelle Demütigung der arabischen Welt durch die westliche Welt und ihren Hegemonieanspruch. Terrorismus ist eine Folge davon.
Licht und Dunkel gibt es also in der heutigen Welt nebeneinander. Das gilt auch für jene Emotionen, welche die Weltpolitik prägen. Chindia, so der Politologie Dominique Moisi aus Frankreich, ist ein Kontinent der Hoffnung. Die arabische Region ist von der westlichen Welt gedemütigt. Die reichen Regionen der Erde aber, Nordamerika und Europa, sind heute von einer Grundstimmung der Angst geprägt. Angst gehört zwar von Anfang an zum menschlichen Leben. Die Tiefenpsychologin Monika Renz hat sich mit dem Entstehen der Angst im Mutterschoß beschäftigt. Da erwacht das Bewusstsein und mit ihm die Angst, dass wir in der Weite der Welt, in die wir hineingeboren sind, verloren sind. Und zugleich fühlen wir die Urangst, dass wir zu wenig haben, um zu überleben.
Diese Urangst bekommt heute bei uns in Europa kulturell Nahrung. Wir leben in einer „Kultur der Angst“ (Frank Furedi), in einer „Angstgesellschaft“ (Heinz Bude). Kulturen, die von der Angst geprägt sind, neigen zur Abgrenzung. Europa, so fordern viele Ängstliche, soll die Grenzen dichtmachen. Europa soll zu einer Festung ausgebaut werden. Angesichts der vielen Schutzsuchenden, die 2015 nach Europa kamen, hatten viele das Gefühl, es werde uns zu viel, dass wir es nicht schaffen. Zugleich wuchs die Angst, dass es für uns nicht mehr reicht, wenn so viele Menschen dazukommen und einen Anspruch auf unseren Sozialstaat erheben.
Die Angst nimmt uns aber die Kraft zur Solidarität. Internationale Solidarität wird durch Nationalismus abgelöst. Ein „defensiver Rassismus“ wächst, so prognostizierten 1991 Experten des Club of Rome. In freien Wahlen kommen weltweit rechtspopulistische Parteien an die Macht. Die liberalen Demokratien werden zunehmend illiberal. Die beiden großen Werte Europas sind in Gefahr: Freiheit und Solidarität – und mit ihnen letztlich die Wahrheit: also die Achtung vor der Würde jedes Menschen, vor den Menschenrechten. Die Angst hat daher im Leben der Einzelnen wie in der Politik fatale Folgen. Den einzelnen Menschen behindert die Angst, ein liebender Mensch und damit ein wahrer Mensch zu werden. In der Politik zerstört die Angst die Solidarität. Ohne diese gibt es aber keine Gerechtigkeit. Und ohne Gerechtigkeit keinen Frieden. Ich verstehen den 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der in seiner Antrittsrede inmitten der Großen Depression von 1933 sagte: „The only thing we have to fear is fear itself.“
Das ist also das Dilemma der Kirche. In ihren eigenen Mitgliedern erlebt sie die Größe, aber auch die Bedrohung Europas konkret mit. In dieser Zeit der großen Herausforderungen ist sie aber mit Priestermangel, Zölibat, Strukturwandel und Rettung des traditionellen Kirchenbetriebs beschäftigt.
Gerade in dieser Zeit könnte die Kirche für die Welt ein Segen sein, wenn sie aus der Kraft des Evangeliums lebt. Denn sie könnte dazu beitragen, die Seele Europas zu heilen, die heute von der Angst „aufgefressen“ wird. Anstelle der Kultur der Angst könnte wenigstens in den kirchlichen Gemeinschaften eine Kultur des Vertrauens wachsen und sich von hier aus in der Welt ausbreiten.
Zu einer solchen Kultur des Vertrauens gehört das gläubige Wissen um die Einheit der Schöpfung, um das eine Welthaus. Wenn nur ein Gott ist, dann ist jeder einer von uns, jede eine von uns. Wenn der fünfjährige Aylan Kurdi in der Ägäis ertrinkt, ertrinkt einer von uns. Wenn ein Glied nicht nur in der Gemeinde, sondern in der Menschheit leidet, leiden wir alle mit. Das ist seit der Atomkatastrophe in Fukushima kein frommer, sondern ein sehr realistischer Satz.
Aus der Einheit im Sein erwächst sodann eine universelle Solidarität. Dies kennt keine Obergrenzen. Einheit im Sein und in der Solidarität sind keine bequemen Wahrheiten, sondern enorme Herausforderungen. Sind wir Christen überzeugt, dass uns dazu Gott die Kraft gibt? Könnten wir nicht inmitten eines Europas der Angst in unseren Kirchen eine „Gegenkultur des Vertrauens“ leben? Könnte dadurch die Angst kleiner, und mit dem Vertrauen die Gerechtigkeit in Europa größer werden? Wachsende Gerechtigkeit ist aber das stärkste Instrument einer nachhaltigen Sicherheitspolitik.
Das könnte uns Kirchen zum Licht der Welt und zum Salz der Erde machen. Jesus hat diese Mission seinen Jüngern auf dem Berg der Seligpreisungen gegeben.
Wir aber können wir als Christ*en selbst lernen, inmitten unserer Ängste zu bestehen? Ein Blick auf Jesus gibt uns die Antwort. Er hat extreme Angst erlitten – nicht zuletzt am Ende seines Lebens. Als Mensch ist er der Angst vor dem Tod nicht ausgewichen. Bestanden hat er in seiner Angst, weil er sich immer verbunden fühlte: Verbunden mit seinem Gott, den er liebevoll Vater nannte. Das ist die beste Anleitung, wie auch wir als Christen Vertrauen lernen. Wer aber vertraut, kann glauben, hoffen und lieben. Wen die Angst beherrscht, muss sich gegen diese verteidigen: privat tun wir die durch Gewalt, Gier und Lüge. Die politischen Strategien gegen die Angst sind Terrorismus, Finanzgier, Korruption.
Der Mystiker aus New-Mexiko, Franziskaner, Richard Rohr, zeigt uns einen guten Weg zum Vertrauen: „It is not necessary to be perfect, but to be connected.“ So wichtig es also für die Kirche in Europa ist, in der Gesellschaft präsent zu sein: Ebenso wichtig ist, dass wir selbst „Verbundene“ sind. Die Politik folgt aus der Mystik, so die großen spirituellen Lehrerinnen und Lehrer wie Roger Schutz, Dorothee Sölle, Johann B. Metz. Bei den Armen am Rand des Lebens und der Gesellschaft taucht auf, wer zuvor in Gott eintaucht. Jesus ging daher nächtens auf den Berg, um seine Gottesverbundenheit zu erleben. Am Morgen geht er dann vom Berg herab, begegnet am Rand des Lebens einem Aussätzigen und liebt diesen ins Leben zurück.
Ich verstehe immer besser, wenn Karl Rahner schrieb: „Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, also einer der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein.“
Dabei ist diese Mystik politisch gefährlich. Wer nämlich sein Knie vor Gott beugt, beugt es niemals mehr vor der Partei. So soll Papst Johannes Paul II. Inmitten des Kriegsrechts in Polen 1979 auf dem Siegesplatz hier in Warschau gepredigt haben.
Junger Wein, das ist“ to be connected“ und von Gott her sich leidenschaftlich um die Armen zu kümmern. Das ist die Kirchenvision von Franziskus.
Wo aber geschieht dieses „to be connected“ heute? Die spirituellen Meister sagen, dass es viele Weg gibt. Aber der Beste ist die Feier der Eucharistie. Da essen wir den Leib Christ – und werden dadurch zum Leib Christi. Von diesem aber heißt es, er sei ein Leib, hingegeben für das Leben der Welt. Es ist ein Skandal, dass dies gefährliche Feier in vielen Bereichen der der katholischen Weltkirche in der Lebensform der Priester geopfert wird.
Gott wurde Mensch, damit die Welt menschlicher wird. Dieselbe Bewegung erwartet Gott von uns, seinem Volk. Wir sind ein Teil der Menschheit. Und allein wenn es in unseren Gemeinschaften menschlicher zugeht, ist bereits ein Teil der Menschheit menschlicher geworden. Und wenn wir zudem in der Welt mitarbeiten, als Politiker, Künstler, in den Medien, der Wissenschaft, in Bildung und Erziehung, in den kleinen Lebenswelten von Ehe und Familie, dann können wir zum Wachsen der Menschlichkeit beitragen. Dabei brauchen wir nicht um Gott besorgt zu sein. Er gibt uns Rückendeckung. Gerade wenn es schwer wird, so eine einfache Frau aus der Flüchtlingsarbeit, dann spüre ich göttlichen Rückenwind. Das ist es, was unsere Kirche in Europa dringend braucht.



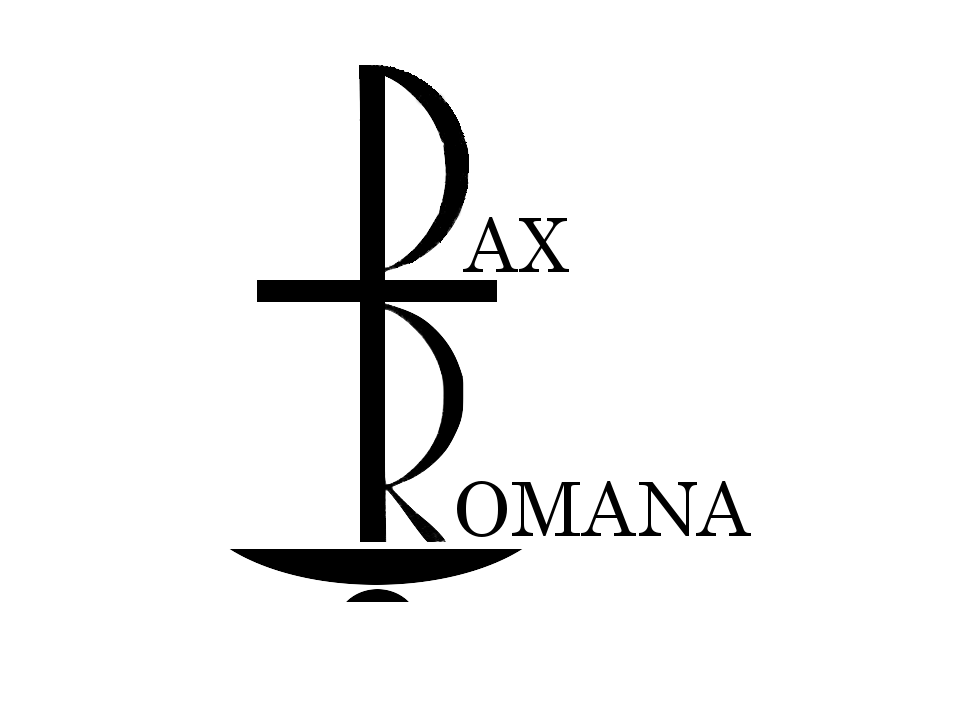

Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.